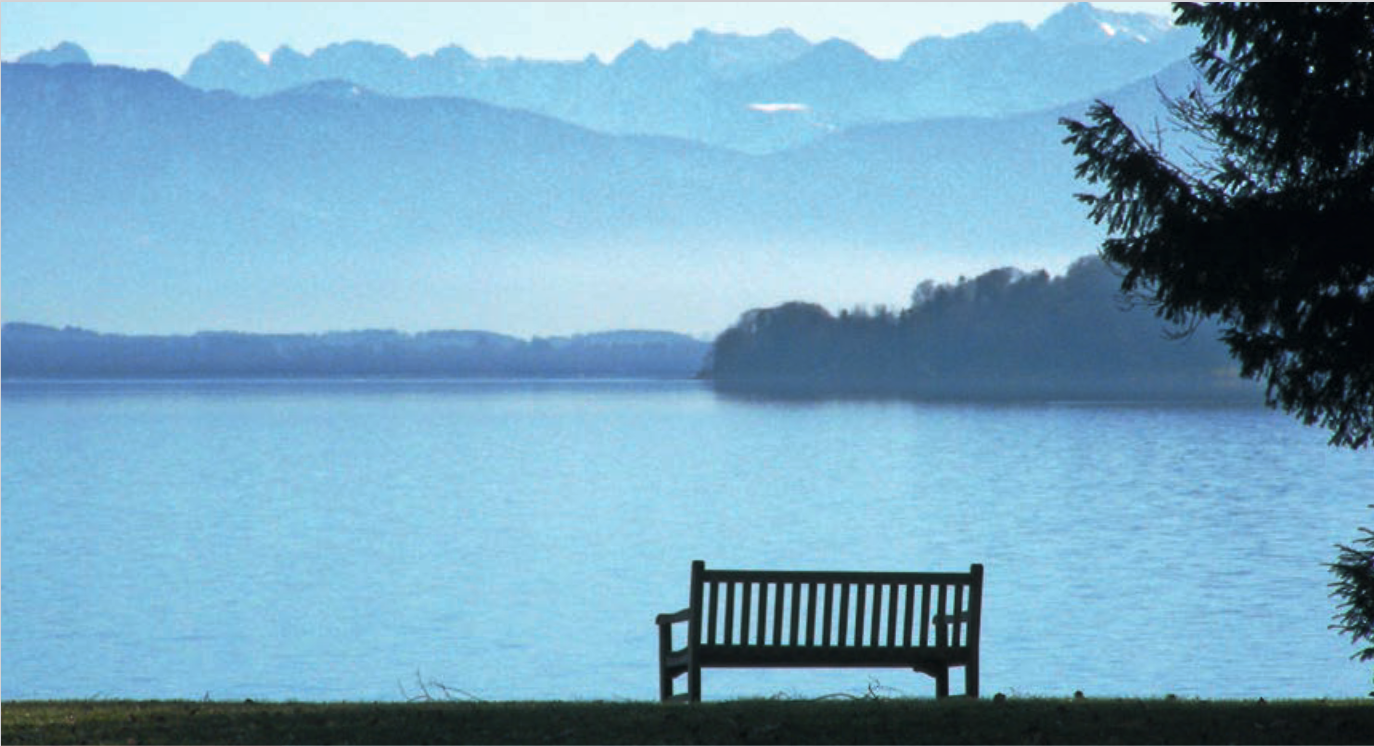Arbeitskreis
Kirchlicher
Investoren (AKI)
Ethisch-nachhaltige
Geldanlage.

Menschen vertrauen ihr Geld der Kirche an, um diakonische und kirchliche Arbeit zu ermöglichen. In Kirche und Diakonie geschieht der Umgang mit Geld in der Verantwortung vor Gott und den Menschen – das gilt auch für Geldanlagen.
Kirchliches Geld wird angelegt, um künftigen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Investiertes Geld bleibt Eigentum der Anlegenden, sie haben Verantwortung für die Wirkungen der Geldanlage.

Um dem gerecht zu werden, werden neben den ökonomischen auch ethisch-nachhaltige Ziele verfolgt: Das Geld von Kirche und Diakonie soll im Einklang mit Gottes Geboten und dem jeweiligen Auftrag angelegt werden.
Daran arbeiten wir mit zwei Schwerpunkten: dem regelmäßig aktualisierten Leitfaden und Engagementdialogen mit Unternehmen – und freuen uns über den Austausch dazu.
Aktuelles
15.03.2024
Der AKI veröffentlicht seine für 2024 geplanten Engagement-Vorhaben im Bereich Umwelt unter dem Titel "Unternehmensverantwortung für Klima und Biodiversität". Welche Erwartungen die kirchlichen Investoren an die Unternehmen haben, mit denen sie in den Dialog treten, wird darin ebenso erläutert wie das konkrete Vorgehen.
Am 29. Mai 2024 | 9:30 - 19:30 Uhr lädt der AKI gemeinsam mit dem VÖB zu der Konferenz: Zukunftssichernde soziale Investitionen – Was müssen wir tun? in die Vertretung des Landes Baden-Württemberg, Tiergartenstraße 15, 10785 Berlin ein. In vier Workshops werden Prioritäten und neue Wege der Finanzierung in den Bereichen Wohnungsbau, Gesundheit, Bildung und soziales Unternehmertum diskutiert. Anmelden können Sie sich hier.
23.02.2024
Die Geschäftsstelle des AKI hat den Arbeitsbericht für 2023 veröffentlicht.
06.11.2023
Die 5. Auflage des Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlage liegt nun in einer englischen Ausgabe vor: Guideline for Ethically-Sustainable Investment in the German Protestant Church
Kontakt & Austausch
Als Mitgliederorganisation tätigt der AKI keine eigenen Geldanlagen. Leider können wir keine Investmentvorschläge an unsere Mitglieder weitergeben.